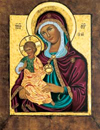Als ich vor einigen Wochen unserer Mitarbeiterin Beate mitteilte, dass der Schwerpunkt der nächsten Ausgabe dem Thema „Vergiss nicht zu danken“ gewidmet sein sollte, machte sie mich darauf aufmerksam, dass wir genau dieses Thema schon einmal thematisiert hatten – vor sieben Jahren. Ehrlich gesagt: Ich hatte das total vergessen.
Ja – und was eigentlich noch schlimmer ist: Ich hatte auch die vielen wertvollen Aspekte, die in den Artikeln damals zur Sprache gekommen waren (auch in meinem), weitgehend aus den Augen verloren. Umso notwendiger also wieder über die Bedeutung der Dankbarkeit nachzudenken, ist sie doch eine Haltung, die für ein erfülltes Leben von entscheidender Bedeutung ist. Haben Sie, liebe Leser, nicht auch den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, in der sich die meisten Menschen mit der Dankbarkeit schwertun? Dass man ihr selten begegnet, sie selbst viel zu wenig empfindet und dass dadurch leicht ein Schatten der Freudlosigkeit auf unseren Alltag fällt?
Peter Dyckhoff beschreibt es treffend (siehe Interview S. 4-5): Wir leben heute in einer Welt, in der seit Jahrzehnten materieller Wohlstand herrscht. In einem hohen Maß perfektionierte Systeme decken unsere Bedürfnisse. Vieles ist automatisiert, auf Selbstbedienung eingerichtet: Drive-in-Fast-Food-Versorgung, Fahrkarten- und Getränkeautomaten, Möbel- oder Sportgeschäfte mit einem Minimum an Personal, Supermärkte… Wem sollte man dankbar sein, wenn man nach langem Warten endlich den Inhalt des Einkaufswagerls auf das Fließband an der Kassa geräumt, gezahlt und hastig die Ware im Papiersack verstaut hat? Schließlich will man ja nicht den Unmut der Kassiererin und der nächsten Kundschaften erregen…
Dazu kommt ein weit verbreites Anspruchsdenken, das die moderne Demokratie pflegt: Sie spricht dem Bürger laufend Rechte zu. Die Liste der Menschenrechte ist lang – und sie wird länger. Mittlerweile umfasst sie etwa ein Recht auf bezahlte Arbeit, Erholung, Freizeit, Bildung… Für all das hat der anonyme Staat zu sorgen, der die Rolle eines allmächtigen Übervaters übernimmt. Er hat für die Befriedigung der „legitimen“ Ansprüche des Bürgers zu sorgen. Nur: Wie sollte man Gefühle der Dankbarkeit gegenüber einem anonymen Gebilde entwickeln? Und warum überhaupt, wenn man doch Anspruch auf dessen Leistungen hat? Ist unter diesen Voraussetzungen nicht eher damit zu rechnen, dass Ärger und Unzufriedenheit aufkommen, wenn den Erwartungen nicht entsprochen wird?
Und noch ein Drittes: Scheinbar im Widerspruch zum eben Gesagten wird dem Menschen seit der Aufklärung suggeriert, er sei autonom, also selbstbestimmt, gewissermaßen seines Glückes Schmied. Die Welt des Sports, der Wirtschaft, der Hochschulen vermittelt den Eindruck: Du schaffst es, Du musst den Erfolg nur wollen, Dich anstrengen – und wenn es heute nicht funktioniert, dann sicher morgen…
Nun machen aber derzeit selbst die reichen Länder die Erfahrung, dass Übervater Staat überfordert ist, den Erwartungen des Bürgers gerecht zu werden: die Arbeitslosigkeit steigt, die Pensionssysteme stehen vor dem Kollaps, die Gesundheitssysteme sind überfordert… Und der einzelne bekommt mit, dass er noch so viel studieren, sich noch so sehr bemühen kann, wenn der Wirtschaftsmotor stottert, gibt es keine Jobs. In Spanien beträgt die Jugendarbeitslosigkeit 55, in Italien 41 Prozent. So macht sich Unzufriedenheit breit. Man hatte schließlich mit einem schier grenzenlosen Aufschwung gerechnet! Und in der Werbung bekommt man täglich die Freuden eines Lebens unter dem Motto „Reich und Schön“ vorgesetzt.
In diesem Umfeld leben wir nun einmal. Und der Ungeist, der hinter dieser Konstellation steht, färbt auf uns alle ab – mehr oder weniger. Ihm gilt es zu widerstehen. Und am besten widersteht man ihm, indem man einen Blick hinter die Kulissen der modernen Scheinwelt wirft. Diese Übung können Christen gar nicht oft genug pflegen. Wer die wohltuende Erfahrung der Dankbarkeit machen will, muss zunächst innehalten, den Alltagstrott unterbrechen, den Blick freimachen für die wahre Grundkonstellation.
Dankbarkeit erfordert also Innehalten, sich bewusst zu machen, wie sehr wir abhängig sind: von äußeren Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben, von Menschen, die wir zum Großteil nicht kennen, aber auch von Verwandten, Freunden, Nachbarn… – und vor allem von Gott. Dieses Innehalten vermittelt mir dann auch die Einsicht: Vieles, was ich tagtäglich in meinem Leben als gesichert ansehe, ist absolut nicht selbstverständlich. Eine eigentlich triviale, aber meist übersehene Einsicht:
n dass ich abends einschlafen kann – wie wohltuend das ist, merken spätestens all jene, die mit Schlafproblemen kämpfen,
n dass mein Pulsschlag regelmäßig ist – wie beängstigend Rhythmusstörungen sind, davon können Betroffene Zeugnis geben,
n dass ich heil von einer Autoreise heimkomme – wie vielen das nicht zuteil wurde, darüber klärt die Unfallstatistik auf… Die Liste ließe sich beliebig verlängern.
Obwohl wir unseren Alltag meist routiniert herunterspulen, tut es gut, sich ab und zu in Erinnerung zu rufen, dass nichts im Leben abgesichert und selbstverständlich ist. Obwohl ich diesen Vorsatz schon vor sieben Jahren gefasst hatte, möchte ich ihn heute erneuern – und dankbarer werden für all das Gute, das mir täglich widerfährt.
Dankbarkeit ist jedoch etwas Anderes als Freude über einen erfreulichen Zustand. Wer dankbar ist, bringt zum Ausdruck, dass er eine andere Person als Urheber der freudigen Erfahrung wahrnimmt und anerkennt. Ich bin jemandem dankbar. Ein anderer hat zu meinem Glück, meiner Freude, meinem Wohlbefinden beigetragen. Mit meinem „Danke“ wende ich mich an eine Person.
Es tut menschlichen Beziehungen gut, wenn wir einander danken und damit zum Ausdruck bringen: deine Gegenwart, dein Tun, deine Worte sind für mich wichtig. Du hast mir einen Dienst – vielleicht auch nur einen ganz kleinen – erwiesen und mir damit Freude gemacht. Letztendlich übermittelt der Dank dem anderen die Botschaft: Es ist gut, dass es dich gibt, du bist wichtig, ohne dich wäre die Welt ärmer, weniger schön.
Das mag etwas übertrieben klingen. Und im Dank für kleine Gesten – jemand hält mir eine Türe offen, ein Auto überlässt mir den Vorrang, jemand bietet mir im Bus den Platz an… – kommt nicht all das Erwähnte zum Ausdruck. Aber es schwingt mit und beschwingt deshalb auch, bringt Freude in den Alltag, baut auf. Daher gilt es, die Augen offen zu halten für die vielen Gelegenheiten, Dankbarkeit zu empfinden und sie zu äußern. Würden nicht viel mehr Ehen Bestand haben, wenn die Partner einander öfter gegenseitig dankten, gerade auch für scheinbar Selbstverständliches? Hätten nicht viel mehr Menschen Freude an ihrer Arbeit, würde man ihre Leistung nicht nur mit Geld, sondern auch mit Dank belohnen?
Und was ist mit den vielen, von denen ich profitiere, aber nicht mit einem Dank erreichen kann: dem Bauern, der die Kuh gemolken hat, deren Milch ich trinke, der Inderin, die das Hemd genäht hat, das ich trage, dem Monteur, der den Aufzug, den ich benütze, gewartet hat? Ja, auch ihnen schulde ich Dank, ohne ihn an den Mann bringen zu können.
Wir Christen haben es da gut. Wir können solchen Dank vor den tragen, der alles in Händen hält, etwa beim Tischgebet, das sonst allzu leicht in Routine erstarrt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass dieser Dank auf geheimnisvolle Weise wirksam und heilsam wird. Und weil wir wissen, dass der lebendige Gott die Quelle von allem Guten ist, kennen wir auch den eigentlichen Adressaten jeder Danksagung: den allmächtigen Gott, der nicht aus der Geschichte abgedankt hat, sondern deren wichtigster Akteur ist.
Gut und schön, aber was sollen die sagen, denen es dreckig geht, die weder ein noch aus wissen? Sollen die sich auch bei Gott für ihre Misere bedanken? Wäre das nicht eine unzumutbare Forderung, die nur dem Hirn eines engstirnigen Frömmlers entspringen kann, mag nun der Einwand kommen.
Wer solchem Einwand begegnen will, dem könnten die Erfahrungen von Herbert Killian (Siehe Portrait S. 16-19) und die Gedanken von P. Luc Emmerich helfen. Ich möchte eine Schlüsselstelle seines Vortrags (S. 8-9) wiederholen. Er spricht darin von Situationen menschlichen Elends und warum es selbst dann Sinn macht, Gott zu loben: „Im Inneren meines Wesens, meines Herzens ist die Gewissheit, die sagt: Herr, ich weiß, dass Du da bist, dass Du allmächtig bist, dass Du mein Heil willst, dass Du das letzte Wort hast und dass alles einen Sinn bekommt. Und daher lobe ich Dich. Ich verstehe zwar gar nichts, aber ich glaube das.“
Damit wird die Dankbarkeit Gott gegenüber zum Prüfstein des Glaubens. Traue ich Gott wirklich zu, dass Er allmächtig ist? Dass Er heute das Heil wirkt? Dass der Apostel Paulus recht hat, wenn er sagt: „Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt…“ (Röm 8,28)?
Sollte Paulus also recht haben, können wir uns dann zurücklehnen und zuschauen, wie es rundherum drunter und drüber geht, weil Gott ja ohnedies alles richtet? Durchaus nicht. Denn es geht darum, zu jenen zu gehören, die Gott lieben und daher auch Seinen Willen tun. Denn nur so bringen wir die Voraussetzung dafür mit, dass Gott dieses rein weltlich gesehen unmögliche Wunder wirken kann, auch größtes Unheil ins Gute zu wenden.
Wer sich allerdings um diese Liebe bemüht, sich für sie öffnet, dem wird die Verheißung zuteil. Und dann ist das Vertrauen darauf, dass Gott alles zum Guten wenden kann, der eigentliche und tiefste Grund, dankbar zu sein. Auf diesem Hintergrund wird verständlich, was Paulus (wohlgemerkt aus dem Gefängnis) an die Philipper schreibt. „Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! (…) Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. (Phil 4,5ff)